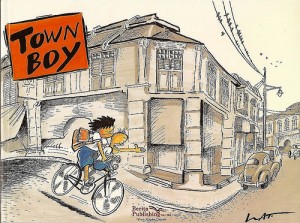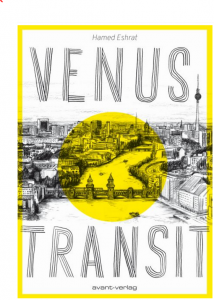 Neues Jahr, neues Leseglück
Neues Jahr, neues Leseglück
von Andreas Platthaus
Sofort loslesen: Hamed Eshrat zeigt mit seiner Lebens- und Liebesgeschichte „Venustransit“, wie gut erzählt deutsche Comics mittlerweile sein können.
Das neue Jahr fängt mit „Venustransit“ denkbar gut an. Venustransit? Das war doch 2012 das große astronomische Ereignis. Ja, genau, aber für den Comic „Venustransit“ gibt das Phänomen lediglich eine Metapher mit vielfachen Assoziationen her: Venus als Göttin der Liebe, durchkreuzte Bahnen, spannende Konstellationen.
Und das Buchdebüt des 1979 in Teheran geborenen, aber seit vielen Jahren in Berlin lebenden Hamed Eshrat bietet einiges an Spannung, unerwarteten Wendungen und Liebeswirren. Das klingt jetzt nach einem Herz-Schmerz-Comic, aber es ist ein – mutmaßlich tief autobiographisch grundierter – Bildungscomicroman, in dem über ein halbes Jahr im Leben von Ben Rama erzählt wird.
Ben ist ein junger Mann mit großen bildkünstlerischen Ambitionen, der sich in Berlin mit einem tristen IT-Bürojob durchschlägt und seine Liebe zu Julia durch seine Unzufriedenheit über die eigene Lebenslage aufs Spiel setzt. So zerbricht diese Liebe auch, und Ben rettet sich aus der resultierenden Niedergeschlagenheit in einen ehemals als gemeinsame Reise geplanten Trip nach Indien. Zurück kommt er verwandelt, findet neue Liebe, neues Glück, wird sogar einen ambitionierten Comic beginnen. Kurz: Es geht gut aus.
Aber bis es soweit ist, lässt Hamed Eshrat uns in einer Intensität und Beobachtungsgenauigkeit an Bens Nöten teilhaben, die ungewöhnlich ist. Diese Elemente hatten mich schon 2014 überzeugt, als Eshrat die damals noch unfertige Geschichte für das erste Berthold-Leibinger-Comicstipendium eingereicht hatte. Er kam damit unter die zehn Finalisten, und er fand einen Verlag (Interesse an dem Band hatten sogar mehrere).
Ins experimentierfreudige Programm von Avant, einem Haus, das mit Ulli Lust eines der wichtigsten Graphic-Novel-Debüts des letzten Jahrzehnts gestemmt hat, passt „Venustransit“ exzellent.
Denn experimentierfreudig ist Eshrat allemal. Allein die Schilderung der Indienreise ist ein Meisterwerk: Dieses umfangreiche „Zwischenspiel“ von „Venustransit“ ist nicht als klassischer Comic erzählt, sondern als Faksimile eines auf der Reise mitgeführten Skizzenbuchs, in das auch zahlreiche Dokumente wie Fahrkarten, Prospekte, Eintrittskarten etc. eingeklebt wurden. Das Prinzip des reproduzierten Reisetagebuchs hat vor nicht allzu langer Zeit (und seltsamerweise auch zum Thema Indien) Sebastian Lörscher mit „Making Friends in Bangalore“ vorgeführt – wobei das eine augenzwinkernde Schilderung weniger Wochen war, während Bens Flucht nach Asien fast einen Winter lang währt und nicht Selbstironie, sondern Selbstfindung im Mittelpunkt steht. Die elliptische Methode (Auslassen der eigentlichen Ereignisse auf der Reise, dafür Präsentation der Resultate in Form der Andenken und vor allem von Bens Skizzen) lässt uns beim Lesen weiter rätseln, in welcher Verfassung Ben wohl nach Berlin zurückkehren wird. Zugleich vollzieht man über die bisweilen rätselhaften Faksimileseiten die Irritation nach, die der Protagonist in der Fremde empfunden haben wird.
Erzählerisch agiert Hamed Eshrat also höchst subtil. Wie sieht es graphisch aus? Ansehen kann man es sich zum Beispiel hier. Dass derzeit Gott und die Welt in Deutschland schwarzweiße Bleistiftcomics zeichnet, dürfte beim Beginn der Arbeit an „Venustransit“ nicht absehbar gewesen sein. Ulli Lusts stilistisches Vorbild ist bereits beim Titelbild klar erkennbar, auch die psychologische Dichte der Beschreibung hat da eine Vorläuferin. Panelrahmen setzt Eshrad nicht, dafür gibt es Stilwechsel, um die Seelenzustände von Ben zu illustrieren. Dass die Grenzen zwischen seinen eigenen Comicversuchen und dem Comic, der von ihm erzählt, bisweilen verwischen, ist ein klug eingesetztes Verfahren.
In den 250 Seiten lernen wir aber nicht nur Ben und seine beiden Freundinnen Julia und später Imma kennen, sondern auch eine kleine Freundesgruppe, die sich in einem von dem Türken Ali betriebenen Berliner Spätkauf trifft. Über Alis Leben wird ebenso geschickt nebenbei in „Venustransit“ erzählt wie über das von Beule, Bens bestem Freund noch aus gemeinsamen Punkzeiten. Wie sich da die Sympathien verschieben (untereinander, aber auch zwischen Leser und Figuren), das gehört zum Interessantesten, was deutsche Comics zuletzt hervorgebracht haben. Wenn dieses Jahr so weiter geht, wie es anfängt, dann dürfen wir das Beste erwarten.