Kein Anlass für Katzenjammer, aber ein Anlass für die „Katzenjammer Kids“
In der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Heide findet derzeit eine Ausstellung statt, die sich Rudolph Dirks widmet, dem hierher stammenden amerikanischen Comicpionier. Und dazu gibt es einen hinreißend schönen Katalog.
Ganz hoch oben in der Republik läuft seit einer Woche eine Comic-Ausstellung. Nein, nicht in Oldenburg, das sind es gleich drei, und außerdem geht es noch viel nördlicher. Heide zum Beispiel, eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein, genauer gesagt im Dithmarschen, von der Elbemündung ein Stück weiter an der Nordseeküste herauf. Aus der Mitte der Republik nicht leicht zu erreichen. Und deshalb werde ich wohl auch in der Restlaufzeit von noch sieben Wochen (bis zum 22. April) nicht dort hingelangen. Ein Jammer. Aber kein Grund für Katzenjammer. Pardon, aber diese bemühte Überleitung musste sein, denn die Ausstellung widmet sich Rudolph Dirks, einem Kind der Stadt Heide, geboren 1877, aber wer weiß das schon. Was viele wissen: Dirks hat die „Katzenjammer Kids“ gezeichnet, einen Comic-Strip, der seit 1897 in amerikanische Zeitungen gedruckt wird, bis heute. Man merkt schon: Lange geblieben sein kann Dirks in Heide nicht. Aber nun holt sich die Stadt ihren großen, ja man kann sagen: größten Sohn zurück.
Nicht nur mit der Ausstellung, sondern auch mit dem dazu erarbeiteten Katalog. Und der ist der Grund, dass von Katzenjammer für die Leute, die es nicht bis zum 22. April nach Heide schaffen werden, keine Rede sein kann. Denn der Katalog ist länger zu haben, weil er im Verlagsprogramm von Christoph A. Bachmann erschienen ist, dem eifrigsten und qualitativ auch besten deutschen Verlag für Comicforschung. Da passt der großformatige, farbig gedruckte du 136 Seiten starke Katalog glänzend hin, denn es wird profund darin geschrieben. Mit Alexander Braun hat man den größten Expe4rten für alte Zeitungscomics gewonnen (übrigens auch als Leihgeber etlicher Originale und gedruckten Seiten, die bis ins späte neunzehnte Jahrhundert zurückgehen. Dazu kommen Texte des jungen Kurators der Ausstellung, Benedikt Brebeck, deren Qualität zu den schönsten Hoffnungen Anlass gibt. Und auch die übrigen Beiträge, die sich nicht zuletzt auch der Lokalgeschichte der Auswanderung widmen, sind alle lesenswert. Der Band ist einfach sorgfältig gemacht.
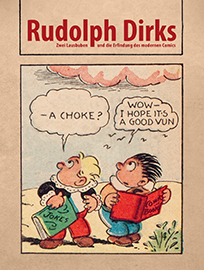
Alles, was die Ausstellung zeigt, hat auch den Weg ins Buch gefunden. Wobei selbst dessen Bilderbuchformat nicht der Anmutung alter Zeitungsseiten ger4echt wird, und die Dirksschen Originale (ganz alte tauchen seltsamerweise nie auf, nicht auf Auktionen, anderen Ausstellungen oder in Sammlungen die meisten bekannten stammen aus den dreißiger und vierziger Jahren) sind auch sehr groß. Also dürfte der Weg auf die Museumsinsel Lüttenheid in Heide, wo die Schau zu sehen ist, allemal lohnen. Schade, dass die ursprüngliche Planung, das Ganze im Hannoveraner Busch-Museum für Karikatur und Zeichenkunst zu zeigen, nicht einmal mehr zu einem späteren Gastspiel dort führen wird.
Die Ausstellung summiert mehr als anderthalb Jahrzehnte Forschung, die in Gang kam, als Dirks Geburtsort identifiziert wurde (zuvor war er fälschlich als „Heinde“ überliefert worden) und Abgesandte der Stadt den damals noch lebenden Sohn John Dirks in Connecticut besuchten, der später den noch vorhandenen Familiennachlass nach Schleswig-Holstein – so erklärt sich die materielle Grundlage der Ausstellung. John Dirks war seinem Vater in den fünfziger Jahren als Zeichner der „Katzenjammer Kids“ gefolgt (die aus rechtlichen Gründen damals „The Captain and the Kids“ hießen, denn gleichzeitig gab es eine Serie unter dem alten Namen, die von jenem Pressekonzern vertrieben wurde, bei dem Dirks 1897 angefangen und den er 1912 verlassen hatte. Die Figuren durfte er mitnehmen, den Namen der Serie nicht. So gab es den eimaligen Fall, dass zwei beinahe gleiche Comic-Strips für Jahrzehnte parallel liefen. Doch „The Captain and the Kids“ hatte den Vorzug, den Erfinder und dann dessen Sohn als Urheber zu haben.
Ausstellung und Katalog dokumentieren aber auch die andere Serie, die „Katzenjammer Kids“ nach 1912, die lange Jahre in den Händen von Harold H. Knerr lagen, der pikanterweise zuvor schon einige Plagiate von Dirks‘ Stil angefertigt hatte. Die Zeitungen kämpften im frühen zwanzigsten Jahrhundert untereinander mit harten Bandagen, und die Rechtslage war alles andere als klar. Der Streit um die Rechte an den „Katzenjammer Kids“ endete in einem Musterprozess, der dann einiges festschrieb, was seitdem in den Vereinigten Staaten urheberrechtlich gilt.
Noch interessanter als diese Aspekte ist allerdings der Blick, den das Dirks-Forschungsprojekt auf einen weiteren Mann dieses Namens wirft: auf Gustav Dirks, den um vier Jahren jüngeren Bruder von Rudolph, der in Amerika auch als Comiczeichner reüssierte und drauf und dran war, den längst etablierten Älteren in der Gunst des Publikums zu überholen – mit seinem Comic-Strip „Bugville“ –, als er sich 1902 im Alter von nur 21 Jahren umbrachte. Warum, ist unklar, auch die jüngste Forschung hat da keine letzte Erklärung parat: Gus Dirks (wie er sich in Amerika nannte) war aller Wahrscheinlichkeit nach depressiv, und es gibt auch Gerüchte, die von Liebeskummer über eine Frau sprechen, die sich für den Bruder entschieden habe. Aber das klingt eine Idee zu spektakulär, als dass ich es glauben mag.
Von Gus Dirks hat sich allein seiner kurzen Schaffenszeit wegen nur wenig erhalten, aber hier wurden für Heide Entdeckungen gemacht. Etwa, dass er den Bruder bei einigen Folgen der jeweils sonntags erscheinenden „Katzenjammer Kids“ im Jahr 1898 als Zeichner vertrat – der Katalog mutmaßt, Rudolph habe sich als Freiwilliger im Spanisch-amerikanischen Krieg gemeldet, während das für den noch minderjährigen Gus nicht in Frage kam. Außerdem hat Alexander Braun einen Cartoon des legendären Zeichners Frederick Burr Opper aus dem Jahr 1899 gefunden, der auf einer Idee von Gus Dirks beruht (was unter Oppers Signatur akribisch vermerkt wurde). Der junge Mann war also schon mitten drin im Comic-Geschäft und arbeitete mit den großen Pionieren zusammen.
Wem das jetzt alles viel zu historiographisch ist, der erfreue ich einfach an den grandiosen Zeichnungen, die – dafür sind die „Katzenjammer Kids“ ja berühmt – von Wilhelm Buschs Vorbild ausgehend die Prinzipien des Comics beinahe im Alleingang entwickeln. Oder besser gesagt: im Passgang, denn offenbar haben sich die Dirks-Brüder gegenseitig in ihren Ideen befeuert. Um diese These zu stützen, bräuchte man indes noch mehr Material von Gus. Aber viel inspirierender als das Heider Projekt kann eine Comic-Ausstellung kaum sein. Der Katalog kostet den Spottpreis von 19,99 Euro und kann hier bestellt werden (eine Leseprobe gibt es nicht, aber hier findet man noch Näheres zur Ausstellung). Natürlich gibt es den Katalog auch im Buchhandel, aber warum soll man dem engagierten Ein-Mann-Verlag nicht das ganze Geld gönnen?
vom 01.03.2018
Fabelhafte Fake News
Staunen Sie, den von diesem Comic-Star haben Sie noch nie gehört. Zu Recht, denn Charlie Chan Hock Chye aus Singapur ist eine Erfindung seines Landsmannes Sonny Liew. Und darum nur umso brillanter.
Was wissen Sie über Singapur? Klar: Stadtstaat, größte Sauberkeit (wegen rigider Strafen), Wirtschaftsmetropole, brutale Eroberung durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg, fabelhafte Fluglinie. So viel wissen wir alle. Aber über die politischen Zustände dort, die jüngere Geschichte, die knapp zweijährige Zugehörigkeit zu Malaysia? Oder gar über Comics aus Singapur?
Über all das und noch viel mehr erfährt man in „The Art of Charlie Chan Hock Chye“, einer – man kann es nicht anders sagen – grandiosen Comicbiographie eines 1938 geborenen Zeichners aus Singapur. Erschienen ist der mehr als dreihundert Seiten starke Band schon vor drei Jahren, aber bis mir ein Freund aus Djakarta davon erzählte, war es schon 2017. Und nachdem der Band eingetroffen war, schob ich die Lektüre monatelang vor mir her. Bis jetzt. Und nach dieser Lektüre sieht meine Comicwelt anders aus.

Sie ist größer geworden, denn nun kenne ich einen fulminanten Zeichner aus Singapur. Und zwar nicht Charlie Chan Hock Chye, denn den gibt es gar nicht wirklich. Ausgedacht hat sich diesen Künstler der 1974 in Malaysia geborene, aber seit langem in Singapur lebende und zeichnende Sonny Liew. Die ganze Biographie Chans ist also fiktiv, die Begleitumstände seines Lebens aber sind es nicht. Es umfasst die ganze Nachkriegsgeschichte Singapurs, also die Befreiung von japanischer Besetzung, den Widerstand gegen die wiederhergestellte englische Herrschaft, die Unabhängigkeit 1959, den erwähnten kurzfristigen Zusammenschluss mit Malaysia und das Aufblühen als Wirtschaftsmacht danach. Aber betrachtet wird das alles aus der Perspektive des Werks von Charlie Chan Hock Chye. Denn Liew dichtet seinem Protagonisten ein politisch engagiertes Schaffen an. Und LIew hat diese Geschichten dann auch eigens gezeichnet.
Und hier wird es spektakulär. Der heute Dreiundvierzigjährige simuliert die Zeichenstile der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, als wäre er bei den großen Meistern in die Schule gegangen. Sein Charlie Chan ist es nämlich zumindest als Leser: Der junge Mann, so erzählt die ihm gewidmete Geschichte, hat Comics von Osamu Tezuka gelesen und deshalb Singapur-Comics im Manga-Stil gezeichnet. Aber auch amerikanische Pulp-Comics, Zeitungsstrips und Disney-Comics, und jeweils nahm er die entsprechenden Gestaltungselemente ins eigene Zeichen auf. Oder Superhelden-Comics. Oder Gekiga (also Manga mit erwachsenen Themen).
In „The Art of Charlie Chan Hock Chye“ finden sich auch Seiten, die von Walt Kelly gezeichnet sein könnten, von Will Eisner, von Harvey Kurtzman, Frank Miller oder sogar Carl Barks. So gut soll dieser Chan gewesen sein. Und so gut ist tatsächlich dieser Sonny Liew (auf der Homepage zum Comic kann man sich das ansehen). Das unterscheidet ihn etwa von dem kanadischen Zeichner Seth, der in „It‘s a Good Life if You Don’t Weaken“ ebenfalls eine imaginäre Zeichnerexistenz samt deren angeblichen Werken geschaffen hatte. Aber da handelte es sich um einen einzigen Stil. Liews Chan dagegen wandelt den seinen im Laufe seiner sechzigjährigen Karriere immer wieder. Was für ein Geniestreich! Was für ein Geniestrich!
In den Vereinigten Staaten, dem Land, wo die meisten der Vorbilder des imaginäre Meisterzeichners stammen, hat man das natürlich rasch gemerkt. „The Art of Charlie Chan Hock Chye“ erschien dort bei Pantheon, also der besten Verlagsadresse für anspruchsvolle Comics in Amerika („Maus“, „Jimmy Corrigan“, „Asterios Polyp“ und viele mehr). Letztes Jahre haben es dann auch die Franzosen gemerkt; dort griff mit Urban Comics ein allerdings noch nicht sehr bekanntes Haus zu. Aber immerhin wurde der Band dort gedruckt, während sich noch kein deutscher Verlag darum gekümmert hat. Um einen der besten Comics der letzten zwanzig Jahre.
Dieses Prädikat hat der Band verdient, weil er einerseits so unglaublich gut gezeichnet ist und weil er andererseits ein Erzählgeschick besitzt, das seinesgleichen sucht. Denn über die angeblich aus früheren Jahrzehnten stammenden Chan-Comics werden in dieser fiktiven Biographie Gespräche geführt, Materialien zusammengetragen und vor allem wiederum Geschichten erzählt, die Politik und Gesellschaft im Singapur seit 1945 anschaulich machen. Fußnoten liefern weitere Informationen zu den realen Hintergründen, und Sonny Liew wiederum tritt selbst als handelnde und kommentierende Figur auf, so dass der Schleier der Illusion immer leicht angehoben bleibt. So gewitzt du vieldeutig ist im Comic wohl noch nie erzählt worden.
Und so herrlich lustvoll gefälscht wohl auch noch nicht. Das Buch quillt über vor Faksimiles von alten Comic-Heften oder Originalseiten, die Chan gezeichnet haben soll, akkurat auf alt getrimmt bis hin zu vergilbtem Papier und Resten von Klebestreifen. Ganze Serien von Probeseiten für nie verwirklichte Projekte werden vorgestellt, und aus der Absage diverser Verlage wird ein neues Comic-Kapitel, das ein Stück Pressegeschichte des Fernen Ostens erzählt. Bis zu vier Erzählebenen finden sich auf einer Seite von Liews Buch, doch deren Trennung wird immer deutlich gemacht durch die graphische Gestaltung: Dem imaginären Chan gehören dabei alle anspruchsvollen Arbeiten, dem echten Liew dagegen die cartonartigen.
Das alles mag komplizierte klingen, als es ist, auch weniger amüsant, als es ist, hermetischer, als es ist. Man braucht Zeit für dieses Buch, viel Zeit sogar, denn es gibt unglaublich viel Text, und fast alles, was erzählt wird, dürfe deutschen Lesern neue sein. Aber wie bei den besten Geschichten von Alan Moore ist der Aufwand, den die Lektüre erfordert, ein reines Vergnügen, weil man Panel für Panel und Fußnote für Fußnote immer klüger wird und auch das Buch selbst immer besser versteht, so dass man am Schluss „The Art of Charlie Chan Hock Chye“ doch fast so schnell lesen kann wie einen vertrauten westlichen Comic. Das ist die Kunst von Sonny Liew, einem Zeichner, der mit diesem Band zu den ganz Großen seiner Zunft gerechnet werden muss.
vom 23.02.2018

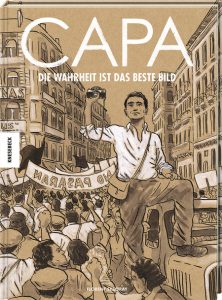


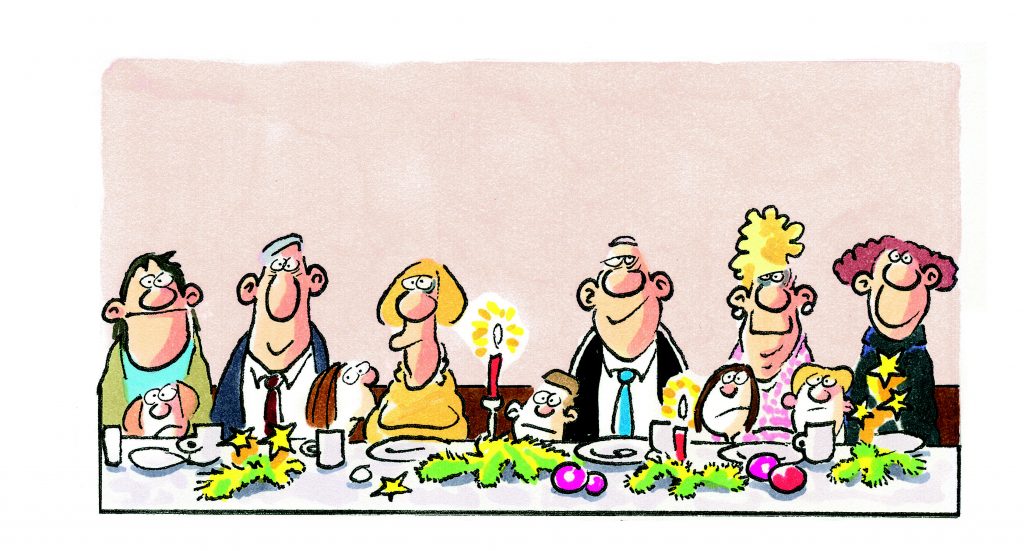
 Francois Durpaire wagt in seinem von Farid Boudjellal gezeichneten Comic „Die Präsidentin“ eine Prognose für die französische Präsidentschaftswahl 2017. Wehe uns und Frankreich, wenn das so käme
Francois Durpaire wagt in seinem von Farid Boudjellal gezeichneten Comic „Die Präsidentin“ eine Prognose für die französische Präsidentschaftswahl 2017. Wehe uns und Frankreich, wenn das so käme