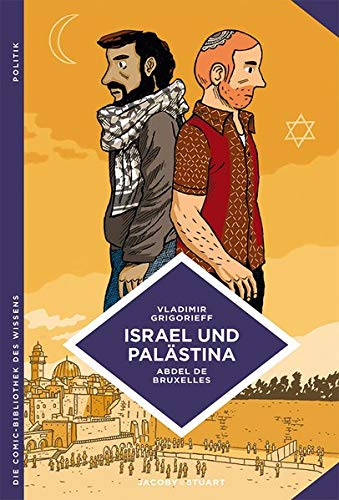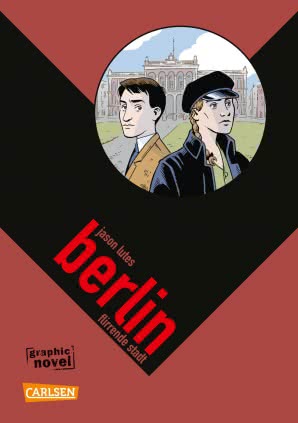Ausgerechnet in Thüringen treiben Untote ihr Unwesen: Olivia Vieweg erzählt eine deutsche Horrorgeschichte, und der Film dazu ist auch schon fertig. Aber wir lesen jetzt erst einmal den Comic.
Mit der Lektüre dieses Comics habe ich mir Zeit gelassen. Das hatte seinen Grund nicht darin, dass er mir von der Zeichnerin Olivia Vieweg mit der Bemerkung zugeschickt wurde: „Ich glaube, Du magst gar keine Horror Comics.“ Da hat sie recht, aber sie wusste auch, dass ich ihre Geschichte namens „Endzeit“ durchaus mochte. Denn erschienen ist sie schon einmal, vor acht Jahren im Kleinverlag Schwarzer Turm, und irgendwo hatte ich dazu mal geschrieben, diese Story sei sehr dunkel und sehr hart. Das war sie auch, aber zugleich sehr gut, weil Genrethemen es im deutschen Comic schwer haben, und diese in Thüringen zwischen Jena und Weimar angesiedelte Zombie-Geschichte war Genre vom Feinsten. Dass sie zur Grundlage eines Drehbuchs werden würde, mit dem Olivia Vieweg 2015 nicht nur einen Preis gewann, sondern das dann auch tatsächlich verfilmt wurde, hätte ich trotzdem nicht gedacht.
Auf diesen Film, dessen Fertigstellung im vergangenen Frühjahr gemeldet wurde, warte ich allerdings immer noch. Premiere hatte er auf dem diesjährigen Kinofestival von Toronto, aber er wird wohl doch nur ins deutsche Fernsehen kommen, für das er auch produziert wurde, zu einem immer noch nicht festgelegten Termin. Eigentlich hatte ich mir die Lektüre der Neuausgabe von „Endzeit“ für den Ausstrahlungstermin aufgespart, doch nun wollte ich nicht noch länger warten.
Warum aber das Ganze noch einmal lesen? Weil der bei Carlsen erschienene neue Comic „Endzeit“ mit dem Original von 2010 nur noch das Grundgerüst gemein hat. Vor allem ist er mehr als dreimal so umfangreich geworden. Das ist kein Einzelfall in der Comicgeschichte; der berühmteste Vergleichsfall ist Art Spiegelmans „Maus“, bei dem aus einer dreiseitigen publizierten Erzählung (1973) schließlich dreihundert Seiten wurden (1991). Natürlich hinkt der Vergleich, und das nicht nur des Mengenverhältnisses wegen. Aber auch „Endzeit“ ist in der zweiten Version deutlich besser geworden, und das hat mit der größeren Länge nur bedingt zu tun.
Die erste Fassung war Olivia Viewegs Diplomarbeit an der Hochschule von Weimar. Da mochte man die Wahl des Handlungsschauplatzes noch als hübsche Reverenz sehen, aber nun, acht Jahre danach, spielt sich das Geschehen immer noch zwischen Weimar und Jena ab. Und es sind immer noch zwei junge Frauen, Vivian und Eva, die durch Zufall gemeinsam mit einem Zug zwischen den beiden befestigten Städten (die sich als einzige Orte gegen eine wenige Jahre zurückliegende Zombieinvasion haben behaupten können) durch offenes und somit gefährliches Terrain unterwegs sind und dann wegen einer Panne auf freier Strecke liegenbleiben. Fortan müssen sie versuchen, sich nach Jena durchzuschlagen.
Dass dabei diverse Überfälle, aber auch unerwartete Konfrontationen stattfinden, wird sich jeder denken, der das Genre kennt. Wobei gegenüber der Erstausgabe alles noch dunkler und härter geworden ist. Hier werden Schädel gespalten und Glieder abgetrennt, sogar Augen ausgestochen, und auch wenn man das nicht immer unmittelbar gezeigt bekommt, tut die eigene Phantasie doch genug dazu, um die Lektüre bedrückend zu machen. Jedoch nicht, weil die Geschichte missglückt wäre, sondern weil es ihr meisterhaft gelingt, Bedrohung zu vermitteln, und zwar nicht nur durch genreübliche Schockelemente. Die Jugend der beiden Mädchen tut ein Übriges dazu, obwohl sich beide als zähe Kämpferinnen erweisen – Vivian erst langsam, Eva von Beginn an.
Evas Rolle hat gegenüber der Ursprungserzählung die größte Veränderung erfahren. 2010 warf uns Olivia Vieweg mitten hinein ins Geschehen und auf den Bahnhof, wo die beiden Mädchen sich jeweils in heikler Mission trafen. Diesmal wird viel Zeit auf die Etablierung der Situation im abgekapselten Weimar verwendet, und Eva wird da schon als eine einzelgängerische Kriegerin gegen die Zombies gezeigt. So sind sich beide Hauptfiguren unähnlicher als ehedem, und die Reibereien zwischen ihnen bringen in der zweiten Fassung ein zusätzliches Spannungselement, als sie schließlich auf einander angewiesen sind. Dass Vivian nicht mehr eine junge Mutter ist, die ihr Kind an die Zombies verloren hat, sondern den Verlust ihrer kleinen Schwester verkraften musste, macht sie nochmal etwas jünger als im Ursprungsband.
Aber auch Weimar ist nicht mehr einfach nur ein sicherer Hafen im Zombie-Meer, sondern selbst ein recht subtil angedeutetes Zwangssystem (das kann man in der Leseprobe überprüfen), in dem niemand besonders sympathisch daherkommt. So wird der Horror auch zur Dystopie, und vor allem gibt es in der neuen Version viel mehr Figuren, was sich im Hinblick auf die Verfilmung als Vorteil erwiesen haben dürfte. Ohne einen Blick auf den Film kann man es nur vermuten, aber mir scheint der Comic sehr nahe am Drehbuch entlang erzählt zu sein, manchmal ist er durchaus filmisch, was ich normalerweise wenig schätze. Aber bei einem so kinogeprägten Stoff wie Zombie-Horror ist das nur adäquat.
Auch der Stil von Olivia Vieweg hat sich gewandelt; kein Wunder nach all den Bucherfolgen der Zwischenzeit. Der Strich ist freier, die Hintergründe sind detaillierter, aber nicht exakter, alles wirkt spontan und wie unter Druck gezeichnet – auch das ideal angesichts der Verfolgungsstimmung des Geschehens. Die Farben, die von zwei Koloristen appliziert wurden, sind abgeschatteter, und die Zombie-Darstellung hat an Drastik zugenommen. Was dagegen geblieben ist, ist die gute Grundidee, Frauen gegen Untote antreten zu lassen. Dieser Zug wird sogar noch dadurch verstärkt, dass in der zweiten Version aus einem hilfreichen Mann noch eine weitere Frau geworden ist, und auch sie ist alles andere als ein Heimchen.
280 Seiten Horrorcomic mit Totschlag und Zerstückelung. Ja, liebe Olivia Vieweg, das mag ich nicht. Aber „Endzeit“ habe ich gemocht. Und auf den Film bin ich nun noch etwas gespannter. Möge das ZDF, in dessen „Kleinem Fernsehspiel“ das Werk wohl seinen Platz finden soll, sich mal etwas sputen. Ich dachte ja immer, Comicmachen brauche schon viel Zeit. Filmemachen und vor allem das Resultat dann unterbringen, ist offenbar noch viel langwieriger. Aber mit der nun eingetretenen Verzögerung war wohl nicht zu rechnen, sonst hätten sich Zeichnerin und Verlag wohl auch noch etwas Zeit gelassen. So wie ich es bei der Lektüre tat. Aber irgendwann ist es ja auch einmal gut mit der Warterei.