
Sondermann-Preis für Thomas Kapielski und Jan Böhmermann
Thomas Kapielski bekommt den Sondermann 2016, weil er seit über dreißig Jahren in Wort, Bild und Ton Erbauliches, Erstaunliches, Erleuchtetes und vor allem sehr Komisches vorgelegt hat. Sei es als Professor für Performance, als Gottesbeweiser oder Experte für „Neue Sezessionistische Heizkörperverkleidungen“, als Fotograf und Objektkünstler, als Stammtischsoziologe und Vortragsartist. Ein verehrungswürdiger Künstler, dem der Ruhm immer wichtiger war als der Erfolg. An seiner Preiswürdigkeit besteht kein Zweifel. Um es mit einem seiner Ausstellungstitel zu sagen: „De dingsbums non est disputandum.“ Den Sondermann-Förderpreis erhält Jan Böhmermann. Wenn sich jemand auf das obsolete Unternehmen TV-Unterhaltung einlässt, jemand, der noch jung genug ist, aus seinem Leben etwas Besseres, womöglich Sinnvolles, zu machen, so verdient das unseren Respekt. Einen solchen Mann wollen wir fördern.
Der Sondermann-Preis ist der höchstdotierte Preis für komische Kunst in Deutschland. Hauptpreisträger Thomas Kapielski erhält 5000 Euro, der förderungswürdige Jan Böhmermann 2000 Euro. Der Preis wird am 11.11.um 20:00 Uhr in der Frankfurter „Brotfabrik“ im Rahmen einer großen, öffentlichen Gala verliehen. Die Preisträger sind anwesend und tragen aus ihren Werken vor.

 Francois Durpaire wagt in seinem von Farid Boudjellal gezeichneten Comic „Die Präsidentin“ eine Prognose für die französische Präsidentschaftswahl 2017. Wehe uns und Frankreich, wenn das so käme
Francois Durpaire wagt in seinem von Farid Boudjellal gezeichneten Comic „Die Präsidentin“ eine Prognose für die französische Präsidentschaftswahl 2017. Wehe uns und Frankreich, wenn das so käme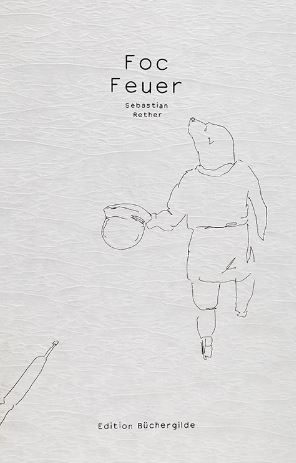 Abstrakter Krieg erschreckt genauso
Abstrakter Krieg erschreckt genauso Dortmund im Schatten des Hakenkreuzes
Dortmund im Schatten des Hakenkreuzes Schöner kann es am Meer selbst nicht sein
Schöner kann es am Meer selbst nicht sein
 Öko-Superkräfte
Öko-Superkräfte Lahmer, tiefer, kürzer?
Lahmer, tiefer, kürzer? In Erlangen erlangt man traurige Erkenntnis
In Erlangen erlangt man traurige Erkenntnis Die Sondermannpreisträger für das Jahr 2016 stehen fest. Einer festlichen Verleihung am 11.11. in der Frankfurter Brotfabrik steht nun nichts mehr im Wege.
Die Sondermannpreisträger für das Jahr 2016 stehen fest. Einer festlichen Verleihung am 11.11. in der Frankfurter Brotfabrik steht nun nichts mehr im Wege.