 Schock nach dem Schlusspfiff
Schock nach dem Schlusspfiff
von Andreas Platthaus
Ganz anders als man denkt, denn es geht gar nicht um Fußball: Guido van Driel erzählt in „Als wir gegen die Deutschen verloren haben“ von einem Mord in einer niederländischen Kleinstadt im Sommer 1974.
Auf der Leipziger Buchmesse hat man manchmal das Glück, Comics zu sehen, die erst in den Tagen danach in den Handel kommen, und manchmal hat man auch das Glück, schon ein Vorabexemplar zu bekommen. So hatte ich plötzlich einen kleinen Band in der Hand, auf den ich mich gefreut hatte, obwohl ich nicht mehr darüber wusste als den Titel: „Als wir gegen die Deutschen verloren haben“. Wer wie ich im Grenzland zu den Niederlanden geboren ist, weiß, was damit gemeint ist: kein Krieg, sondern ein Sportereignis, das am 7. Juli 1974 stattfand, das Finale der Fußballweltmeisterschaft im Olympiastadion von München. 2:1 gewann die Bundesrepublik Deutschland gegen die Niederlande. Oder Franz Beckenbauer gegen Johan Cruijff (ja, so schreibt er sich wirklich, „Cruyff“ war ein Kompromiss für die internationale Karriere), um die beiden Kapitäne und Weltstars ihrer Mannschaften zu nennen. In den Augen unserer Nachbarn war die Niederlage völlig ungerechtfertigt. Ein Trauma.
Ein Comic, der so einen Titel trägt, stammt natürlich aus den Niederlanden. Dort ist er schon vor vierzehn Jahren erschienen. Warum es so lange dauerte, bis eine Übersetzung herauskam, ist leicht erklärt: Die niederländische Comicszene ist eine der aktivsten in Europa, aber in Deutschland kennt man davon nur wenig. Daran wird die Ehrengastrolle des flämischen Sprachraums auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse einiges ändern. Wobei Hannes Ulrich, der Verleger von Avant, bei dem „Als wir gegen die Deutschen verloren haben“ erscheint, mit ein wenig Skepsis in Richtung Herbst blickt. „Als ich kürzlich mit einer Dame vom belgisch-flämischen Kulturbüro sprach, meinte sie, es sei ja klar, dass die Comics aus Belgien den niederländischen überlegen seien. Das sehe ich ganz anders. Aber unter den jetzt schon erschienenen Comics aus dem dortigen Sprachraum sind noch viel mehr belgische.“
Also hält Avant dagegen, und Guido van Driels „Toen wij van de Duitsers verloren“ ist blendend geeignet, die Stärke niederländischer Comics zu belegen (zumal wenn sie so schön übersetzt sind wie dieser hier von Annelie David). Im graphischen Stil und auch der sozialen Umgebung der Handlung ist van Driel ganz nahe bei dem Franzosen Baru, aber schon die ungewöhnliche Seitenarchitektur, die kein festes Raster kennt, sondern die jeweiligen Bilder zu Blöcken arrangiert, die wechselnde Freiräume auf der Seite lassen, verleiht dem Band eine ganz eigene Optik. Van Driel verdichtet und verschiebt seine Erzählmomente auf subjektive Weise – ein Abbild von Erinnerung, die ständig in Bewegung ist, nie statisch, und das passt, weil der Comic dezidiert als ein autobiographisch inspirierter ausgewiesen ist.
Van Driel wurde 1962 geboren und wuchs in Zaandam, einer Vorstadt von Amsterdam auf. 1974 hat er die sechsjährige niederländische Grundschule beendet, und sein Comic beginnt mit dem Abschlussfoto einer solchen Klasse, aufgenommen vor den Sommerferien, nach denen die Schüler sich auf die unterschiedlichen weiterführenden Schulen verteilen werden. Im Mittelpunkt des Fotos sieht man Jonas, den Protagonisten von „Als wir gegen die Deutschen verloren haben“.
Das blonde Mädchen rechts von ihm fällt erst nicht besonders auf. Im Laufe der Handlung erfährt man, dass ihr Name Helene ist und dass sie seit einigen Tagen vermisst wird. Wenn man zurückblättert, sieht man, dass Helene die einzige Blonde auf dem Foto ist und als solche heraussticht, und es sind solche Winzigkeiten, die immer wieder wichtig werden in diesem Comic, der im Zentrum eine Kindesmordgeschichte erzählt (und auflöst), während man meinen könnte, eine nostalgische Reminiszenz an eine Jugend in den frühen siebziger Jahren zu lesen.
Guido van Driel tut einiges, um diese falsche Plotspur zu legen, denn durch den Handlungszeitpunkt am Tag nach dem verlorenen Endspiel von München liegt eine generelle Depression auf dem sommerlichen Montag in Zaandam, und die bedrohlichen Nachrichten über Helenes Verschwinden nimmt man zunächst als nur einen weiteren Aspekt der Niedergeschlagenheit. Dann aber setzt sich immer mehr ein Puzzle zusammen, aus dem am Ende ein Bild hinter den Bildern entsteht – mit dem einzigen Schönheitsfehler, dass die Motivation des Täters auf eine Begebenheit im Zweiten Weltkrieg zurückgeht, die doch arg plakativ geraten ist.
Was dagegen reines Glück ist, sind die Farben: kräftig und doch abgeblasst, mit einem impressionistischen Touch, der perfekt zu diesem schwermütigen Sommertag passt (Leseprobe). Van Driel vermag es geschickt, die spezifische Ferienstimmung von Jonas und seinem Schulkameraden Daan zu vermitteln, die beide über ihre Enttäuschung vom Vortag hinwegmüssen. Zugleich stammen sie aus gegensätzliche sozialen Welten, und selbst dieses Element wird sich als wichtig für die unterschwellige Mordgeschichte erweisen. Selten habe ich einen Comic gelesen, der so subtil konstruiert war.
Was aber das Schönste daran ist: Obwohl Jonas der eindeutig wichtigste Akteur ist, entwickelt man an jeder Figur, und tauche sie auch noch so kurz auf, ein tiefes Interesse. Und über diese Menschen kommt uns eine Zeit, in der wir selbst nur ein paar Jahre jünger waren als van Driel, geradezu unheimlich nahe. Denn bis auf die Kleidung und die Interieurs ist das, was in „Als wir gegen die Deutschen verloren haben“ von zeitloser Gültigkeit.

 von Andreas Platthaus
von Andreas Platthaus Ein Leben für die Kunst
Ein Leben für die Kunst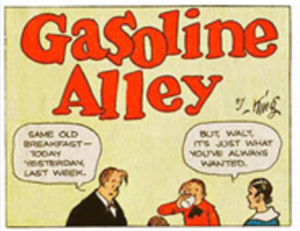 Herzlichen Glückwunsch dem 95jährigen Geburtstagskind
Herzlichen Glückwunsch dem 95jährigen Geburtstagskind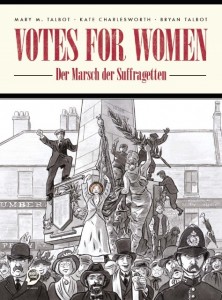 Starke Frauen, im Comic noch kämpferischer
Starke Frauen, im Comic noch kämpferischer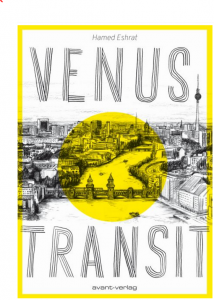 Neues Jahr, neues Leseglück
Neues Jahr, neues Leseglück


