 Aufgeweckte Altstars
Aufgeweckte Altstars
von Andreas Platthaus
In Frankreich feiert ein neues Konzept Triumphe: Prominente Autoren und Zeichner nehmen sich klassischer Serien und Helden an und erzählen auf ihre Weise deren Abenteuer. Derzeit auf den Bestsellerlisten: Lucky Luke und Micky Maus
Auf den Comic-Bestsellerlisten in Frankreich, dem umsatzstärksten europäischen Land für diese Branche, stehen derzeit drei Titel weit oben, die jeweils neue Blicke auf legendäre alte Serien werfen. Matthieu Bonhomme hat einen „Lucky Luke“-Band gezeichnet, der nicht Teil der regulären, seit fast siebzig Jahren laufenden Serie ist, und gleich zwei Alben widmen sich Walt Disneys Micky Maus, noch dazu in höchst prominenter Besetzung: Den einen hat der ebenso populäre wie poetische Cosey geschrieben und gezeichnet, für den zweiten hat Lewis Trondheim, der Revolutionär unter der mittleren Generation französischer Comic-Künstler, zur Feder gegriffen. Alle sind sie mit diesen neuen Projekten erfolgreicher als mit den eigenen der letzten Jahre.
Pech, dass ein Teil der daraus resultierenden Einnahmen an die Rechteinhaber gehen wird: an den Disney-Konzern und an die Erben des 2001 verstorbenen Morris. Aber immerhin haben sie ihre Genehmigungen erteilt, die weltbekannten Figuren überhaupt benützen zu dürfen. Das hätte es im Falle von Hergés „Tim und Struppi“ oder Goscinny/Uderzos „Asterix“ nie gegeben. Die dritte legendäre Serie der französischsprachigen Comicgeschichte allerdings hat vorgemacht, wie man einem Klassiker neues Blut und vor allem neue Leser zuführen kann: Neben der bereits seit 1938 laufenden Reihe „Spirou“ gibt es seit einigen Jahren Sonderbände, die von prominenten Gastautoren und -zeichnern bestritten werden, und da gleich der erste, Émile Bravos „Porträt eines Helden als junger Tor“ von 2008, ein Sensationserfolg war, ist das Konzept seitdem immer weiter ausgebaut worden – wobei die Qualität unter der Häufung durchaus gelitten hat, der Verkauf aber offenbar nicht. Derzeit sitzt Bravo aber selbst wieder an einem solchen Band, und man hört, es werde sich um ein Werk von mehr als zweihundert Seiten handeln. Unerhört im „Spirou“-Kosmos. Das wird spannend.
Aber auch ohne solche Längenextreme bieten die außerhalb der Reihen laufendenden Bände zumindest vom Üblichen abweichende Formate. Bonhommes „L’Homme qui tua Lucky Luke“ (Der Mann, der Luck Luke getötet hat) etwa hat vierundsechzig Seiten, eines der beiden Standardformate im frankobelgischen Albengeschäft, aber das ungewöhnliche längere, denn alle alten „Lucky Luke“-Episoden sind auf achtundvierzig Seiten ausgelegt gewesen. Durch den zusätzlichen Umfang erzählt Bonhomme ruhiger als Morris oder dessen aktueller Nachfolger Achdé, und Lucky Comics hat als Rechteinhaber Wert darauf gelegt, dass mit diesem Sonderband auch graphisch etwas Besonderes passiert. Bonhommes eher realistisch gezeichneter Lucky Luke knüpft einerseits an jene Phase von Morris an, als der Zeichner in den fünfziger Jahren die erste Unbeholfenheit abgelegt, aber auch noch nicht den flüssigen, uns heute vertrauten Stil der Sechziger und Siebziger gefunden hatte. Andererseits greift Bonhomme in Seitenarchitektur und Farbgebung das Vorbild des berühmtesten aller französischsprachigen Western-Comics auf: Jean Girauds „Blueberry“.
So gelingt ihm das Kunststück, eine ernsthaftere Welt, als sonst in der Serie üblich, mit doch graphisch vertrauten Figuren zu füllen (Leseprobe). Besonders die Nebenfigur Doc Wednesday ist wie aus einem klassischen „Lucky Luke“ entsprungen, während die Familie Bone als Gegenspieler à la Giraud gehalten wird – was sie ungleich bedrohlicher macht als frühere Schurken wie etwa die Daltons. In diesem Band wird auch gestorben, und Psychologie spielt eine wichtige Rolle, aber zugleich ist „L’Homme qui tua Lucky Luke“ die Arbeit eines Liebenden, der die Stimmung der Serie nur um solche Nuancen erweitert, die dem Geist des Originals verpflichtet sind. Bis hin zum Grabstein eines gewissen Morris, „from Bevere“, auf dem Friedhof der Kleinstadt Frog Town, wo das Geschehen angesiedelt ist. Wer weiß, dass der bürgerliche Name des ursprünglichen Zeichners Maurice de Bevère war, kommt hier auf seine Kosten.
Über die Handlung, vor allem natürlich in Bezug auf den Titel, hier kein Wort, denn der Band lebt nicht zuletzt von einer Grundspannung, die just dadurch entsteht, dass es hier tatsächlich um Leben und Tod geht. Auch um Liebe übrigens. Und um eine Lücke in der „Lucky Luke“-Saga, die Bonhomme inhaltlich zwingend schließt: den Übergang vom zigaretterauchenden Cowboy zum strohhalmkauenden. Was in Wirklichkeit die Forderung amerikanischer Sittenwächter war, um ein jugendliches Publikum nicht zum Rauchen zu verführen, wird bei Bonhomme zur freien Entscheidung Lucky Lukes, und es lohnt allein schon deshalb, diesen Band zu lesen.
Eine ähnliche Absicht treibt Cosey mit seinem ebenfalls vierundsechzigseitigen Micky-Maus-Band „Une mystérieuse mélodie“ (Eine geheimnisvolle Melodie) an. Auch er ergänzt ein in der bekannten Saga fehlendes Element: nämlich, wie sich Micky und Minnie kennengelernt haben. Dazu versetzt er das Geschehen ins Jahr 1927, in dem sein Micky Maus als Drehbuchautor für einen Hollywood-Filmmogul arbeitet und sich neuen Herausforderungen stellen muss, die ihn in eine aberwitzige Handlung hineinziehen, die von einem verlorengegangenen Manuskript erzählt. Hier ist die Geschichte weitaus weniger wichtig als bei Bonhommes „Lucky Luke“-Band; Cosey nimmt sie zum Anlass, Szenerien und Figuren vorzustellen, die einem Disney-Liebhaber zutiefst vertraut sind, bis hin zu Goofys erstem Namen Dingo oder dem kleinen Hausboot, auf dem Donald Duck zu ersten Mal gesichtet wurde. Selbst der Titel ist eine Hommage an die Disney-Trickfilmserie „Silly Symphonies“ – wie überhaupt zahllose Dekors und Details, die Cosey in seinen Plot zu integrieren versteht. Das Ganze ist zudem in den flächigen Farben der frühen Comic-Strips gedruckt, und das Personal stammt samt und sonders aus den dreißiger Jahren, überwiegend aus Geschichten von Floyd Gottfredson, dem Meister des damaligen Micky-Maus-Comic-Strips (leider wie auch beim Trondheim-Titel desselben Verlags keine Leseprobe, nur allgemeine Informationen).
Eine ganze andere Comic-Epoche hat sich Lewis Trondheim als Bezugszeit ausgesucht: Er siedelt „Mickey’s Craziest Adventures“ in den sechziger Jahren an und orientiert sich an dem atemlosen Stil italienischer Disney-Geschichten aus jener Zeit, in der er selbst sie als Kind gelesen haben dürfte. Wobei er diesmal nur die Handlung geschrieben und dann einen Zeichner mit der Umsetzung seines Szenarios beauftragt hat: den 1972 geborenen Nicolas Keramidas. Gemeinsam haben sie eine Erzählfiktion ersonnen, die darauf beruht, dass auf einem Flohmarkt einzelne Hefte einer angeblichen amerikanischen Heftreihe namens „Mickey’s Quest“ aufgetaucht sein sollen, deren Episoden nun hier ins Französische übersetzt zum Abdruck kommen – leider unvollständig, da auch immer wieder Lücken in dem aufgefundenen Konvolut bestanden hätten. So kommt auf achtundvierzig Seiten eine Geschichte zum Abdruck, die eigentlich aus zweiundachtzig Episoden bestehen sollte, und die Handlung überspringt immer wieder einiges vom Geschehen, ohne dass man aber Schwierigkeiten hätte, ihm zu folgen. Denn die Story folgt den Gesetzen eines Fortsetzungscomics, die Trondheim meisterhaft einzusetzen weiß.
Bei ihm wird keinerlei Bezug auf Disney-Klassiker genommen, obwohl er selbst den legendären Donald-Zeichner Carl Barks als einen seiner wichtigsten Einflüsse nennt. Immerhin ist Donald Duck hier ständig an Mickys Seite, und mit Dagobert Duck, Daniel Düsentrieb, Gustav Gans, den Panzerknackern oder dem Fähnlein Fieselschweif sind etliche Barks-Schöpfungen in Nebenrollen vertreten. Aber auch Kater Karlo tritt als Nemesis auf und einiges anderes altes Gottfredson-Personal, so dass hier disney-untypisch die beiden Welten von Entenhausen und Mausburg zusammengeführt werden. Das hatten in größerem Stil in der Tat nur die italienischen Zeichner gewagt.
Mit ihren Comics haben sie in den sechziger Jahren zu einem Gutteil das französische „Journal de Mickey“ bestückt, so dass Trondheims Faszination für just diesen überdynamisch-elastischen Stil erklärlich ist. Gleichzeitig treiben er und Keramidas die Erzählfiktion dadurch auf die Spitze, dass sie Flecken auf die Seiten applizieren, das Papier vergilbt drucken lassen, einmal sogar die untere Partie einer Seite als abgerissen fingieren – so, wie ein Zufalls-Comicfund auf dem Speicher eben aussehen mag. Das macht Spaß, doch leider ist Trondheim im Unterschied zu Cosey nichts Rechtes zu den Figuren eingefallen. Außer dass sie aussehen wie Micky und Donald, unterscheidet die Protagonisten nichts von anderen Trondheim-Helden aus dessen ironisch mit Genrekonventionen spielendem Werk. Diese Geschichte hätte vor Jahren auch ein Bestandteil von „Herrn Hases haarsträubenden Abenteuern“ sein können, in denen Trondheim die verschiedensten Erzählgenres parodiert hat.
Aber man kann mit Berühmtheiten wie Lucky Luke, Micky Maus oder Donald Duck selbstverständlich kommerziell gar nichts falsch machen, egal, wie geschickt man zu erzählen weiß. Umso bemerkenswerter, wie grandios es Bonhomme gelungen ist, sein Vorbild zu variieren, und wie hinreißend unschuldig es Cosey gemacht hat. Bei Trondheim merkt man jeder Szene die Metareferenzialität an, aber das ist es gerade nicht, was den Mythos eines Comic-Klassikers ausmacht. Bis man die drei Bände auf Deutsch wird lesen können, dürfte es noch ein paar Monate dauern. „Lucky Luke“ wird gewiss erscheinen, ob Disney aber die zunächst nur für den französischen Sprachraum genehmigte Verwendung seiner Figuren angesichts des Erfolgs auf andere Märkte ausdehnt, ist eine spannende Frage. Nicht nur, weil dann Coseys und Trondheims Geschichten auch deutsch zugänglich würden, sondern weil dann auch für deutsche Zeichner ähnliche Möglichkeiten bestünden. Donald Duck von Flix oder Ralf König? Ein Traum!

 Die Büchse der „Pandora“ sprudelt reichhaltig
Die Büchse der „Pandora“ sprudelt reichhaltig Es handelt sich um den wertvollen Kunstdruck des Bernd-Pfarr-Gemäldes: „Der Yeti freute sich sehr über die hübsche Sangria-Karaffe, die er bei den Ausrüstungsgegenständen des am K 2 verunglückten Bergsteigers gefunden hatte.“ Und dazu gibt’s zwei zauberhafte Yeti-Püppchen, handgefertigt von nepalesischen Frauen im Rahmen eines Entwicklungsprojekts.
Es handelt sich um den wertvollen Kunstdruck des Bernd-Pfarr-Gemäldes: „Der Yeti freute sich sehr über die hübsche Sangria-Karaffe, die er bei den Ausrüstungsgegenständen des am K 2 verunglückten Bergsteigers gefunden hatte.“ Und dazu gibt’s zwei zauberhafte Yeti-Püppchen, handgefertigt von nepalesischen Frauen im Rahmen eines Entwicklungsprojekts.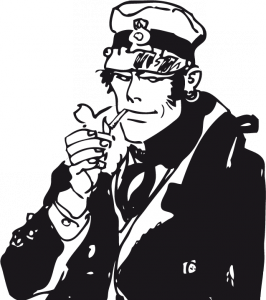 Die Lücke im Cortoversum
Die Lücke im Cortoversum Fakten vs. Pathos
Fakten vs. Pathos Nachdem die Cloud einen Wolkenbruch erlebt hat
Nachdem die Cloud einen Wolkenbruch erlebt hat
 Immer wieder diese kriegerischen Nachbarn!
Immer wieder diese kriegerischen Nachbarn! Schon sehr früh im Jahr steht er fest: der Sondermann-Stipendiat 2016! In jährlicher Folge unterstützt der Verein einen jungen Autor oder Zeichner aus dem Bereich der Komischen Kunst bei einem dreimonatigen Arbeitsaufenthalt in Frankfurt und ermöglicht ihm Praktika in verschiedenen Medienhäusern (TITANIC, Caricatura, FAZ, FR) – unabhängig von den Regularien des Sondermann-Preises.
Schon sehr früh im Jahr steht er fest: der Sondermann-Stipendiat 2016! In jährlicher Folge unterstützt der Verein einen jungen Autor oder Zeichner aus dem Bereich der Komischen Kunst bei einem dreimonatigen Arbeitsaufenthalt in Frankfurt und ermöglicht ihm Praktika in verschiedenen Medienhäusern (TITANIC, Caricatura, FAZ, FR) – unabhängig von den Regularien des Sondermann-Preises. Nur noch wenige Wochen, dann wird der nächste Sondermann-Preis für außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der komischen Kunst vergeben.
Nur noch wenige Wochen, dann wird der nächste Sondermann-Preis für außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der komischen Kunst vergeben.